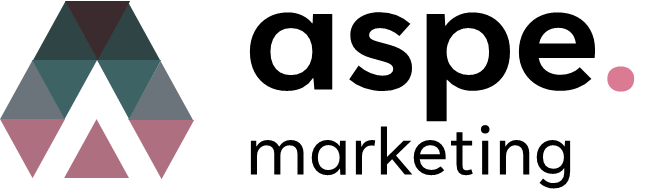Einsatz von CDPs: global, lokal, egal?
Wenn du für ein international oder global agierendes Unternehmen tätig bist und damit beauftragt wurdest, eine #customerdataplatform für die ultimative Omni-Channel Customer Experience für deine Kunden einzuführen, wirst du dir vermutlich die Frage nach dem sinnvollsten Betriebsmodell für deine CDP stellen. Dabei stehen dir gleich mehrere Optionen zur Auswahl:
- Du führst die CDP zentral ein und verwaltest auch die Use Cases darin zentral.
- Du führst die CDP zentral ein, dezentralisierst aber die Umsetzung von Use Cases, indem du die Use Case Operations in deine lokalen Teams auslagerst.
- Du führst die CDP erstmal nur in einem Markt ein, baust dort einen Blueprint und rollst diesen dann angepasst an lokale Gegebenheiten aus, wobei der Betrieb dann auch im jeweiligen Markt erfolgt.
- Du führst die CDP zentral ein, verwaltest aber lediglich die Lizenz. Die Märkte nutzen diese dann in vollem Umfang lokal auf eigene Faust.
- Du erklärst den lokalen Marketern lediglich, warum du der Meinung bist, dass sie eine CDP benötigen. Auswahl, Einkauf und Betrieb machen die lokalen Mitarbeiter dann aber selbst.
Es gibt da sicherlich noch weitere Varianten und Nuancen dazwischen. Bevor du dich aber auf eine der Möglichkeiten festlegst, solltest du unbedingt die Implikationen kennen, die deine Entscheidung mit sich führt.
Lokal ist einfacher, oder?
In den meisten Fällen wird das Handling einer lokalen CDP-Lösung die mit Abstand einfachere Variante sein. Datenschutzrechtlich musst du nur einen Markt betrachten, die Anzahl von Stakeholdern, mit denen du dich abstimmen musst, ist überschaubar. Die Datenquellen müssen nur für einen Markt angeschlossen und Datenstrukturen aufbereitet werden, die Anzahl der Konnektoren für die Aktivierung der Kampagnen ist ebenfalls überschaubar etc. Wenn es nur so einfach wäre, wäre der Beitrag an dieser Stelle bereits vorbei und ich säße schon auf meiner Terrasse mit einem Feierabendbier in der Hand und der Sonne im Gesicht. Es gibt nämlich durchaus gute Gründe, wieso du dir ggf. trotzdem Gedanken über eine globale Strategie für deine Omni-Channel-Architektur machen solltest.
Kosten und Aufwände
Zum einen wären da die Lizenz- und Kostenvorteile einer globalen CDP-Lizenz. Desto mehr Events du über deine CDP feuerst, umso niedriger die Kosten pro Event. Gliederst du das hingegen auf viele einzelne Accounts oder gar lokal unterschiedliche CDP-Lösungen, betreiben alle lokalen Teams die CDP zu höheren Kosten pro Event. Darüber hinaus möchtest du deine Kampagnen und Use Cases ggf. global umsetzen und nicht pro Markt. Bspw. willst du eventuell Warenkorbabbrecher in der DACH Region mit gleichen Angeboten „targeten“. In einem globalen Account musst du den Use Case entsprechend nur einmal bauen, statt ihn pro Markt aufzusetzen. Das reduziert wiederum nicht nur die Setup Kosten für den Use Case, sondern spiegelt sich auch langfristig in der Maintenance und Optimierung der Use Cases wider. Das setzt aber auch voraus, dass deine Werbenetzwerke global organisiert sind. Andernfalls läufst du Gefahr, den Überblick bei den Konnektoren für die Aktivierung zu verlieren. Stell dir vor, du hast 30 Märkte und alle haben einen eigenen Tiktok und DV360 Account. Dann hast du zentral schon mal 60 Konnektoren, die du verwalten musst.
Team-Synergien und Know-How Transfer
Darüber hinaus benötigt man für den Betrieb einer CDP ein cross-funktionales Team, bestehend aus verschiedensten Rollen wie z.B. Daten-Experten, Audience Managern und technischen Profilen. Falls du das pro Markt lokal abbilden kannst, Glückwunsch! Viele Leser werden dich dafür beneiden.
In den meisten Fällen dürfte das aber zu Kapazitätsengpässen führen.
Baust du ein solches Team aber nur einmal auf, kannst du auch hier signifikante Synergien rausholen. Gleichzeitig hast du den Vorteil, dass ein zentral organisiertes Team das gesamte Know-How trägt und dieses entsprechend in alle Märkte übertragen kann, während der Know-How Transfer bei lokalen Teams sehr viel schwerer zu organisieren ist.
Standardisierung ist der Schlüssel für globale CDP-Ansätze
Im Kontext einer Customer Data Platform, die so viele neue Möglichkeiten für eine effiziente Omni-Channel Experience schafft, dürfte der Begriff „Standardisierung“ zu einem entsetzten Zusammenzucken bei dem einen oder anderen Leser/in führen. Aber genau das ist der Trade-Off, wenn du von den beschriebenen Vorteilen wie Kosteneffizienz und Synergien profitieren möchtest. Voraussetzung hierfür ist aber eine global möglichst harmonisierte Infrastruktur mit gleichen oder ähnlichen Datenquellen, Datenstrukturen, Use Cases und im besten Fall auch identischen Aktivierungskanälen. Ist das der Fall, kannst du neue Ideen und Kampagnen mit maximaler Effizienz gleich global ausrollen. Das gibt dir zudem die Möglichkeit, mit deinen Tech-Experten einen Release-Zyklus mit Standard-Releases einzuführen, was nicht nur die Release-Kommunikation in Richtung deiner internationalen Stakeholder vereinfacht, sondern auch die Aufwände bei der Maintenance deutlich reduziert. Wenn deine Websites, Online-Shops oder CRM-Systeme international aber unterschiedlich sind, wird sicherlich auch die Datenstruktur eine andere sein. Selbst bei identischen Use Cases musst du dann pro Markt eigene Audiences bauen und jede CDP Instanz wird zu einer Custom Lösung. Eine solche Struktur zentral zu verwalten dürfte ziemlich schnell zu einem Albtraum werden.
Fazit
Im Prinzip ist die Faustformel ganz einfach:
je einheitlicher dein globales Setup ist, umso eher lohnt sich eine zentrale Strategie für deine Customer Data Platform.
Entscheidend sind aber vor allem die Daten und deren globale Verfügbarkeit. Kannst du global mit den gleichen Datenstrukturen arbeiten, kannst du auch deine Audience-Strategie und damit dann auch deine Use Cases international vereinheitlichen. In der Regel ist die Realität aber etwas komplizierter als nur schwarz oder weiß. Du musst dann für dich entscheiden, welche Vorteile für dich wichtiger sind oder mit welchen Nachteilen du besser leben kannst.
5 Gründe, warum CDP Einführungen scheitern
Du planst die Einführung einer Customer Data Platform (kurz CDP) in deinem Unternehmen? Dann hast du sicherlich schon einige CDP Anbieter kennengelernt und verstehst die unzähligen Vorteile, die eine CDP im Herzen deiner Martech Architektur hat. Aber kennst du auch die Stolpersteine, die dem einen oder anderen Product Owner einer CDP die Schweißperlen auf die Stirn treiben? Daher widme ich diesen Beitrag den aus meiner Sicht 5 wichtigsten Hürden, die eine CDP Einführung erschweren oder sogar zum Scheitern verurteilen.
1) Daten, Daten, Daten
Ok, du hast deine CDP Ausschreibung mit Bravour gemeistert, deine Organisation hat mittlerweile verstanden, dass CDP keine Abkürzung für eine neue Partei ist und jetzt kann es losgehen. Dein Backlog ist voll mit Ideen, was man mit der CDP jetzt so alles anstellen könnte und du bist bereit, deine Kunden mit einer Omni-Channel Experience zu beglücken, die die Welt noch nicht gesehen hat. Doch dann die Ernüchterung: Du wolltest doch eigentlich einfach nur die Online-Daten deines Online-Shops nutzen, um die ultimativen Use Cases zu bauen. Doch die Datenqualität ist leider nicht so gut, wie du gehofft hattest. Die Datenattribute haben kryptische Bezeichnungen, die du nicht zuordnen kannst. Deine Online-Daten sind lückenhaft und maximal heterogen. Jede Online-Plattform nutzt ein anderes Tracking-Konzept und schließlich hat jeder Markt die Daten in seiner Sprache benannt, was die Deutung und Zusammenführung von Conversions nahezu unmöglich macht. Zudem stellst du fest, dass deine CRM-Daten, die du ja eigentlich mit den Echtzeit-Online-Daten koppeln – neudeutsch stitchen – wolltest, lückenhaft sind und jeder Markt sein eigenes CRM-System nutzt. Als wäre das nicht genug äußern die Händler der Europäischen Märkte starke Bedenken bzgl. der Datenschutzkonformität und plötzlich fehlt dir die datenschutzrechtliche Grundlage für die Nutzung der Kundendaten.
Ja ich gebe zu, ich habe hier etwas dick aufgetragen, aber das sind reale Herausforderungen, die so in verschiedenen Nuancen den Product Owner für die CDP treffen.
Eine solide Datenbasis ist das A und O einer CDP-Einführung.
Gerade im Kontext global oder international agierender Unternehmen ist das Thema komplex.
Ohne die nötige Datenqualität und eine gezielte Datenstrategie für 1st Party Daten wirst du spätestens bei der Skalierung deiner Use Cases oder der CDP Roll-Outs in Schwierigkeiten geraten.
Es gibt viele verschiedene Ansätze, dieser Herausforderung zu begegnen, um deine CDP Einführung zum Erfolg zu bringen. Bereite deine Datenbasis gut auf die CDP Einführung vor und suche dir kleine Stücke aus dem Datenkuchen, um iterativ über die Komplexität Herr/in zu werden.
2) Fehlende 1st Party Daten Audience Strategie
Du hast die Herausforderung gemeistert und deine ersten Datenquellen füttern die CDP bereits, während dich deine Kollegen/innen als den Herrn der Realtime-Data feiern. Jetzt musst du die Daten nur noch in Targeting-Regeln gießen und daraus Audiences basteln. Ggf. hast du bereits reichlich Erfahrungen gesammelt, deine 1st Party Daten zu segmentieren oder in deinem Web-Analytics Tool präzise Audiences zu bauen. Herausfordernd wird es aber bspw. dann, wenn du plötzlich Online- und Offline-Daten hast und diese nun in Kombination verwenden kannst.
Das ermöglicht dir nicht nur völlig neue Strategien, sondern erfordert zum Teil völlig neue Denkmuster.
Unter Umständen stellt sich dann zudem die organisatorische Frage, wer eigentlich der Owner der Use Cases mit gemischten Datentöpfen ist. Ist das der Marketing- oder doch der Aftersales-Bereich? Globale Setups von CDPs bergen zudem die Herausforderung, dass ggf. international weder die Datenbasis identisch ist noch dieselben Plattformen und Touchpoints verfügbar sind. Das ist dann vor allem im Sinne der Skalierung von Use Cases ein echtes Problem. Aber selbst, wenn du in keine dieser Herausforderungen rennst, wirst du spätestens nach ein paar dutzend Audiences in der CDP merken, wie wichtig eine eindeutige Bezeichnung und einheitliche Taxonomie ist und wie essenziell die Struktur deiner Audiences in der CDP ist. Je nach Kommunikations-Kanal, in dem du diese Audiences aktivieren willst, solltest du unbedingt die Besonderheiten kennen. Planst du bspw. die Aktivierung über Social Media-Kanäle, muss deine Audience die magische Marke von 1000 Nutzern für das Retargeting knacken. Ein E-Commerce Unternehmen wie Zalando lacht vermutlich darüber, ein B2B-Unternehmen mit weniger Traffic auf den eigenen Seiten hat es da aber schon deutlich schwerer. Für Owned Channels wie Website oder Newsletter gelten diese Limitierungen nicht, aber ggf. musst du hierfür gesondert sog. Ausschluss-Regeln anpassen (über diese sog. Exclusions entscheidet man, wann ein Nutzer aus einer bestimmten Zielgruppe fällt), um möglichst viele Nutzer personalisiert über die Owned-Kanäle ansprechen zu können.
3) Überreizung mit der Fülle der neuen Möglichkeiten
Die Customer Data Plattformen sind ein echter Game-Changer im Marketing.
Sie führen verschiedene Datenquellen zusammen und überbrücken die Online- und die Offline-Welt. Sie verwandeln das Buzzword „Omni-Channel“ in Realität und bringen dank der serverseitigen Integration mit Media-Kanälen auch gleich noch eine Lösung für das Cookieless-Future Dilemma mit. So verlockend diese Fähigkeiten sind, so komplex können sie werden.
Die Gefahr ist groß, dass man sich bei der Integration von Datenquellen in endlose Schnittstellen-Projekte stürzt.
Wieso hier nicht auch gleich noch die IoT-Daten (Internet of Things) hinzufügen und dann am besten auch gleich noch 3rd Party Daten ergänzen? Diese bisherigen Datensilos müssen natürlich auch irgendwie verknüpft werden. Also baust du dir gleich noch einen ID-Graph, der sicherheitshalber schon mögliche Szenarien der kommenden 20 Jahre umfasst. Und bei der Aktivierung, … naja wieso nicht aus dem vollen schöpfen. Du hast vielleicht bisher nur die eine DSP genutzt, aber wenn die CDP doch schon mal 100te von built-in Konnektoren verfügt, wieso sollte man sie dann nicht anbinden? Und weil sich viele dieser Konnektoren sowohl Client- als auch Server-seitig anbinden lassen, machst du am besten gleich beides. Sicher verfügt deine CDP auch über AI Fähigkeiten und die Prediction Use Cases sind zum Greifen nah.
Ja, die CDP ist in der Tat eine kleine Revolution im Management von Customer Journeys.
Der Versuch, all diese Fähigkeiten auf einmal auszuschöpfen wird in einer endlosen Schleife von Abstimmungen mit allen Daten- und Kanalverantwortlichen enden, gepaart mit exzessiven Schnittstellen-Implementierungs-Orgien.
Schneide den Elefanten daher lieber in Scheiben im Sinne einer agilen Annäherung deiner Use Cases an deine Zielvision. Starte erstmal nur mit einer Datenquelle und baue erste Use Cases damit. Aktiviere die Audiences vielleicht erstmal in zwei Kanälen und schaffe so schon mal einen ersten Mehrwert mit der CDP. Sammle erste Erfahrungen damit und iteriere dich von Datenquelle zu Datenquelle und von Kanal zu Kanal. So schaffst du Sprint für Sprint zusätzlichen Mehrwert und die Learnings kannst du direkt in deine nächsten Use Cases einfließen lassen.
4) Kein skalierbares Betriebsmodell
Als erfahrener Projektmanager hast du es dank guter Vorbereitung der Daten, einer ausgefeilten Audience-Strategie und einem guten Gespür für agile und iterative Implementierungsansätze geschafft, die ersten Use Cases zum Leben zu erwecken. Die Kampagne übertrifft alle Erwartungen und keiner in deiner Organisation hinterfragt mehr, ob sich denn der ganze Aufwand der CDP-Einführung gelohnt hat. Deine Martech-Truppe knallt Audience für Audience raus und die Zahl der Konnektoren nimmt stetig zu. Aber wer optimiert eigentlich die laufenden Kampagnen? Wer prüft, ob Audiences volllaufen und aktivierbar sind? Und wie finden Change Requests oder Incident Meldungen ihren Weg zu den Verantwortlichen? Und hast du dir mal Gedanken zum Service Level Agreement für die Lösung von Bugs oder die Implementierung neuer Use Cases gemacht? Es fällt dir wie Schuppen von den Augen: Du hast zwar ein Implementierungs- und Roll-Out Team, aber keine Operations-Truppe. Zu allem Überfluss verlässt ein Teammitglied deiner Martech-Mannschaft das Unternehmen, aber die Umsetzung der Audiences und Schnittstellen sind nirgends dokumentiert. Release Notes suchst du vergeblich. Und dann verabschiedet sich auch noch die API zu deinem CRM. Aber natürlich merkst du das erstmal nicht, weil sich keiner dafür zuständig fühlt.
Klar, es ist immer spannender, Innovationen zu treiben und neue Möglichkeiten auszureizen. Aber die Pflege von Bestandslösungen gehört genauso dazu, wie die Implementierung und der Roll-Out der Lösung. Was für Software-Entwickler und Architekten ein Low-Brainer ist, ist für das Marketing-Umfeld noch relativ neu. SaaS lautet da das Stichwort, also Software as a Service. Da kümmert sich doch eh der Anbieter um alles, oder? Nicht ganz, denn die Komplexität einer CDP mit all ihren Konnektoren und Abhängigkeiten zu weiteren Systemen ist ein kritischer Knotenpunkt in deiner Architektur. Denke daran, dass ggf. ein nicht unerheblicher Teil deines Media Spendings darüber läuft und der Betrieb der Plattform entsprechend sichergestellt sein muss.
5) Fragmentierte Organisationsstrukturen und unklare Zuständigkeiten
Je nachdem, wo die Customer Data Plattform in deiner Organisation angesiedelt ist, also Marketing, Sales, IT oder doch bei den Data Analysten, kann die Umsetzung von Use Cases ein echter Kraftakt werden. Du brauchst Daten von den Datenexperten oder von den Sales-Teams, die Architekturfreigabe von den IT-Kollegen und für die Aktivierung sind ggf. verschiedene Teams involviert. Zum einen sind da die Media Buyer, die Social Media Experten und die DSP-Verantwortlichen, zum anderen willst du ggf. auch Owned Channels integrieren und benötigst den Support des Newsletter-Teams. Und wenn du deinen Online-Shop auch noch personalisieren willst, dann brauchst du ggf. auch den E-Commerce Product Owner.
Gelingt es dir, alle Parteien ins Boot zu holen und dir deren Unterstützung zu sichern, wird in den meisten Fällen relativ bald eine Frage aufkommen:
Wer ist eigentlich für diese plattform- und kanal-übergreifenden Use Cases verantwortlich?
Was passiert eigentlich, wenn jeder Kommunikationskanal bis dato seine eigenen Audiences gebaut hat und diese nun zentral aus einer Customer Data Platform geliefert werden? Und wie stellst du dann eigentlich sicher, dass deine Zielgruppen nicht an jedem Touchpoint eine andere Message und völlig willkürliche Assets erhalten? Du wirst schnell merken, dass diese Rolle in den meisten Fällen noch gar nicht besetzt ist. Denn was du jetzt benötigst ist eine Art Journey Manager, der die Fäden übergreifend zusammenhält und so die Nutzeransprache über alle Kanäle hinweg harmonisiert.
Fazit
Vielleicht fragst du dich jetzt, ob die Sache mit der CDP wirklich eine gute Idee war. Nun ja, Argumente für die Erweiterung deiner Marketing-Architektur um eine CDP gibt es viele. Ich will dir mit diesem Beitrag keineswegs Angst machen. Keine der oben beschriebenen „Herausforderungen“ ist unlösbar und ja, obwohl ich dich hier davor gewarnt habe, wirst du trotzdem, aufgrund der Komplexität des Themas, in das eine oder andere Problem hineinlaufen. Ich hoffe allerdings, dass ich dir mit diesem Beitrag einige Kopfschmerzen ersparen konnte und wünsche dir viel Erfolg bei deinem Customer Data Platform Projekt. Gerne stehe ich auch für einen persönlichen Austausch zu dem Thema zur Verfügung. Schreibe mich hier auf LinkedIn einfach direkt an.
Diese 3 Einflussfaktoren werden das Marketing in den nächsten 5 Jahren besonders prägen
Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber oft hat Marketing den Ruf der „bunten Bildchen Bastler“, alles scheint subjektiv zu sein und Marketing kann doch wirklich jeder, oder? Kein Vorstand käme je auf die Idee, sich den Software-Code für die neue App nochmal anzusehen, bevor er live geht, aber die Marketing Kampagne möchte er/sie bitte freigeben. Dabei übersehen viele aber, wieviel Hirnschmalz im „Backend“ einer Kampagne stecken kann, sei es durch den Einsatz intelligenter SaaS Lösungen oder durch die ausgefeilten Datenkonzepte für das Targeting der Nutzer. Ich möchte daher die aus meiner Sicht 3 wichtigsten Einflussgrößen skizzieren, die das Marketing in den kommenden 5 Jahren besonders prägen werden und damit dann hoffentlich endgültig mit den Vorurteilen dieses Fachbereichs aufräumen.
1. Marketing wird zunehmend technischer
Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeiten, als du neben dem Produktkatalog auch noch einen Flyer produziert hast und deine Kampagne ihre Krönung bereits darin fand, dass ein persönliches Mailing an deine Kunden herausging, gepaart mit einem Radiospot, der landesweit dazu lief. Dann kam die Website dazu und plötzlich musstest du dich mit Themen wie Content Management Systemen, SEO und Newslettern auseinandersetzen, gefolgt von Mobile First Ansätzen, Apps, Social Media Tool Boxes etc. Waren es 2011 noch ca. 150 Anbieter für Marketing-Technologien, sind es heute knapp 10.000 sog. Martech-Lösungen, Tendenz stark steigend.
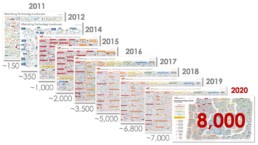
Was bedeutet das für das Marketing?
Klar, zunächst mal bieten so viele Lösungen eine ganze Menge neuer Möglichkeiten, vorausgesetzt man ist in der Lage, diese Software-Angebote entsprechend zu nutzen und zu benutzen. Das CMS wird ggf. ergänzt um ein PIM und CDN, integriert den Shop via Webservices, füttert das Tracking mit Daten, welches dann die Daten in die CDP einspeist, in der wiederum die Audiences gebaut und über das Marketing Automation Tool ausgespielt werden. Darüber hinaus ist mit der CDP auch das CMS oder eine DCO verknüpft. Der Shop ist wiederum mit einem ERP- und einem Fullfilment-System verbunden usw. Dieser kleine Auszug von willkürlich erscheinenden Abkürzungen zeigt bereits, wie viele Systeme ich in einer Marketing-Software-Architektur ggf. berücksichtigen muss.
Ohne einen sog. Martech-Architekten ist das kaum leistbar.
Dazu kommen die Technologie-Experten, die wiederum in der Lage sein müssen, die Tools entsprechend auch aufzusetzen, zu bedienen und zu verwalten. Für gewöhnlich käme jetzt der Einspruch, dass das meistens reine SaaS Anbieter sind (SaaS = Software as a Service), die jeder bedienen kann. Und ja, auf viele Tools trifft das sicherlich zu. Aber die Implementierung einer Marketing Automation Lösung, die Planung einer Headless CMS-Architektur, die Konfiguration eines CRM-Systems oder die Einführung einer Customer Data Platform sind ohne eine technische Marketing Rolle nicht möglich.
Ich höre jetzt den einen oder anderen Geschäftsführer protestieren, dafür habe man ja schließlich eine IT aufgebaut. Und ja, sicherlich ist hier eine enge Verzahnung sinnvoll, bspw. um Schnittstellen zwischen den SaaS Lösungen mit selbstentwickelten On-Premise Lösungen aufzubauen oder ähnliches. Aber ein IT-Spezialist für SAP ERP wird hier leider nur bedingt helfen können. Gefragt sind technische Fachexperten, die sich im stetig wachsenden Kosmos von Marketing- und Sales-lastigen SaaS Lösungen auskennen und wissen, wie sie diese zu einer performanten und zugleich flexiblen Architektur unter Berücksichtigung der bestehen IT-Infrastruktur eines Unternehmens verknüpfen.
Ich kann dir heute noch nicht sagen, welche neuen Wahnsinns-Tools es in 5 Jahren in der Marketing-Szene gibt, aber eines kann ich dir versprechen: Ohne die neue Rolle eines technischer Marketers und einer schlagkräftigen Martech-Truppe werden die kommenden Jahre eine echte Herausforderung.
2. Marketing wird zunehmend datengetriebener
In den vergangenen Jahren gab es immer wieder neue Begriffe und Trends, um die Bedeutung von Daten im Marketing zu betonen. Egal ob Big Data, Data Lake, Predictive Audiences, AI-based Personalization, Clean-Rooms oder Next best Action – auch wenn jeder etwas anderes darunter versteht, sind sich doch alle darüber einig:
Daten werden im Marketing zunehmend wichtiger.
Klar, Daten sind auch im Marketing nicht neu. Marktforschung gibt es schon lange, egal ob es um Brand-Awareness oder -Perception Studien geht. Kunden-Segmente werden im CRM schon lange gebildet und Reports der Tracking-Daten oder Social Media Reports sind auch nicht neu. Neu ist aber die zunehmende Professionalisierung in diesem Bereich und die Vernetzung von bisherigen Daten-Silos zu einem 360° Kunden-Profil. Tracking-Daten werden zunehmend umfassender, Customer Data Plattformen oder Data Lakes ermöglichen zudem die Zusammenführung von Echtzeit-Daten aus der Online-welt mit den Daten aus dem CRM-System oder der IoT Nutzungs-Daten. Audiences und damit das Targeting werden immer präziser und dank der Data-Analysten können immer bessere Vorhersagen für die Next Best Action getroffen werden. BI- und AI-Spezialisten modellieren die optimale Audience auf Basis von Daten-Variablen, auf die man als Normalsterblicher nie gekommen wäre.
Das Spiel gewinnt aber sicherlich niemand, der die meisten Daten sammelt. Die hohe Kunst besteht in der Vernetzung und Verwertung dieser Daten.
Daten sind kein Selbstzweck, sondern dienen einem höheren Ziel: Mehr Effizienz, Mehr Kundenzufriedenheit, gezielte Kundenansprache zur richtigen Zeit am richtigen Ort usw. Und genau das geht nur, wenn es gelingt, Daten-Silos aufzubrechen und die daraus generierten Erkenntnisse über alle Kunden-Touchpoints hinweg nutzbar zu machen.
Das Schreckgespenst „Cookieless Future“ oder das „Sterben der 3rd Party Cookies“ leisten ebenfalls ihren Beitrag zur Bedeutung von Daten, im speziellen Fall für 1s Party Daten. Wenn deine Facebook Pixel nicht mehr in der Lage sind, deine Besucher zielgenau zu re-targeten, dann brauchst du einen Plan B. 1st Party Daten, neue ID-Konzepte und Server-seitige Integrationen der Kommunikationskanäle werden dann zum Schlüssel für deine Wettbewerbsfähigkeit.
3. Marketing-Organisationen werden zunehmend komplexer
Wie sieht bei dir und deinem Team die typische Kampagnenplanung aus? Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ist das nicht oft so, dass man sich zusammensetzt, es wird ein Ziel ausgegeben, man einigt sich auf die Eck-Feiler der Kommunikation und dann waltet jedes Team-Mitglied seines Amtes und setzt die Maßnahme in seinem Zuständigkeitsbereich um? Die Social Media Experten setzen die Kommunikation in den Media Channels auf, die CMS-Verantwortlichen planen das Webspecial usw. Ich bin fest davon überzeugt, wenn du an die ersten beiden von mir benannten Trends glaubst, wird das Marketing der Zukunft so nicht mehr funktionieren.
Wenn du Technologie-Landschaften hast, die zunehmend auf Vernetzung ausgelegt sind und du hast Datenflüsse, die möglichst Journey-übergreifend fließen sollen, dann musst du über gewisse Knotenpunkte in deiner Planung, deinen Prozessen und deiner Architektur nachdenken, die die Kommunikation orchestrieren.
Wenn der Nutzer via Social Media konvertiert ist, willst du ihn nicht auf allen anderen Kanälen immer noch mit der alten Nachricht nerven, sondern möchtest ggf., dass der Newsletter bereits das Folge-Angebot für ihn bereit hält etc. Mit der Frage nach der Vernetzung der Kommunikations-Maßnahmen folgt automatisch die Frage, welche Software-Lösungen du ggf. noch in deiner Marketing-Architektur benötigst und welche weiteren Datenquellen du dafür erschließen musst.
Eine Frage wird bei alle dem aber unbeantwortet bleiben und ich garantiere dir, die Antwort darauf wird nicht immer einfach werden: Wer verwaltet eigentlich diese Knotenpunkte in deiner Marketing-Architektur? Wer ist für die Audiences oder die Software zuständig, wenn du CRM und Tracking Daten kombinierst und daraus Audiences bildest? Ist das Aftersales, Sales oder doch Marketing? Und wer ist für die Audiences und Kampagnen verantwortlich, wenn ein zentral bereit gestellter Audience-Orchestrator Kanäle wie TikTok, DV360 und den Newsletter bespielt? … Spontan kommt dir ggf. die Antwort, das muss doch der Marketing Leiter oder die Marketing Direktorin als Strategiegeber sein. Aber die kümmern sich in der Regel nicht um den operativen Betrieb vernetzter Martech-Architekturen.
Was du künftig dringend brauchen wirst ist eine Art Journey Manager, der die strategische Vorgabe und Ausrichtung einer Kampagne im operativen Doing umsetzt und verwaltet.
Aber diese vergleichsweise neue und bislang wenig etablierte Marketing-Rolle hat ein großes Problem: Die Rolle ist neu, die Rolle ist meist nicht klar definiert und die Rolle hat keine Governance. Das heißt praktisch: die Rolle ist aktuell rein von dem Wohlwollen der etablierten Marketing-Bereiche abhängig, was die Mission so zum Scheitern verurteilen wird. Denn keiner gibt freiwillig Kontrolle auf.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Marketing-Organisationen der Zukunft primär um diese Rolle herum gebaut werden müssen. In der Übergangsphase wird das für die neuen Journey Manager aber ein Klinkenputzen, Lobbyarbeit und ein Trial and Error innerhalb ihrer Organisation werden.
Fazit
Ich bin kein Prophet und natürlich ist das eine subjektive Einzelmeinung von mir, die ich aus meiner beruflichen Erfahrung ableite. Aber die beschriebenen Trends sind auch heute schon spürbar. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie die kommenden Jahre deutlich an Intensität und Geschwindigkeit zunehmen werden.
Ein Punkt, den ich aus Rücksicht auf die Leser mal ausgespart habe, sei hier abschließend noch zumindest erwähnt: Mit der zunehmenden Software-Lastigkeit und der organisatorischen Komplexität durch die Vernetzung der Maßnahmen wird das Marketing der Zukunft nicht drum herumkommen, sich neue Kollaborationsmodelle zu überlegen. Ich empfehle jedem Marketer, sich am besten schon mal mit Confluence und Jira vertraut zu machen. Die Software-Entwicklung hat es dank agiler Methoden geschafft, die Komplexität der (fr)agilen digitalen Welt in den Griff zu bekommen. Wieso sollte das nicht auch in einer von Software, Daten und Abhängigkeiten geprägten neuen Marketing-Welt funktionieren?