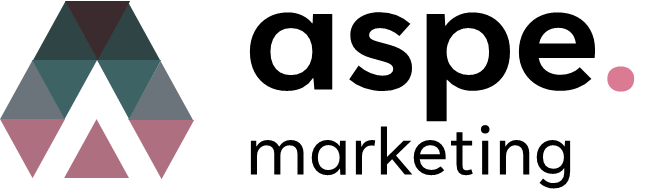Wenn du für ein international oder global agierendes Unternehmen tätig bist und damit beauftragt wurdest, eine #customerdataplatform für die ultimative Omni-Channel Customer Experience für deine Kunden einzuführen, wirst du dir vermutlich die Frage nach dem sinnvollsten Betriebsmodell für deine CDP stellen. Dabei stehen dir gleich mehrere Optionen zur Auswahl:
- Du führst die CDP zentral ein und verwaltest auch die Use Cases darin zentral.
- Du führst die CDP zentral ein, dezentralisierst aber die Umsetzung von Use Cases, indem du die Use Case Operations in deine lokalen Teams auslagerst.
- Du führst die CDP erstmal nur in einem Markt ein, baust dort einen Blueprint und rollst diesen dann angepasst an lokale Gegebenheiten aus, wobei der Betrieb dann auch im jeweiligen Markt erfolgt.
- Du führst die CDP zentral ein, verwaltest aber lediglich die Lizenz. Die Märkte nutzen diese dann in vollem Umfang lokal auf eigene Faust.
- Du erklärst den lokalen Marketern lediglich, warum du der Meinung bist, dass sie eine CDP benötigen. Auswahl, Einkauf und Betrieb machen die lokalen Mitarbeiter dann aber selbst.
Es gibt da sicherlich noch weitere Varianten und Nuancen dazwischen. Bevor du dich aber auf eine der Möglichkeiten festlegst, solltest du unbedingt die Implikationen kennen, die deine Entscheidung mit sich führt.
Lokal ist einfacher, oder?
In den meisten Fällen wird das Handling einer lokalen CDP-Lösung die mit Abstand einfachere Variante sein. Datenschutzrechtlich musst du nur einen Markt betrachten, die Anzahl von Stakeholdern, mit denen du dich abstimmen musst, ist überschaubar. Die Datenquellen müssen nur für einen Markt angeschlossen und Datenstrukturen aufbereitet werden, die Anzahl der Konnektoren für die Aktivierung der Kampagnen ist ebenfalls überschaubar etc. Wenn es nur so einfach wäre, wäre der Beitrag an dieser Stelle bereits vorbei und ich säße schon auf meiner Terrasse mit einem Feierabendbier in der Hand und der Sonne im Gesicht. Es gibt nämlich durchaus gute Gründe, wieso du dir ggf. trotzdem Gedanken über eine globale Strategie für deine Omni-Channel-Architektur machen solltest.
Kosten und Aufwände
Zum einen wären da die Lizenz- und Kostenvorteile einer globalen CDP-Lizenz. Desto mehr Events du über deine CDP feuerst, umso niedriger die Kosten pro Event. Gliederst du das hingegen auf viele einzelne Accounts oder gar lokal unterschiedliche CDP-Lösungen, betreiben alle lokalen Teams die CDP zu höheren Kosten pro Event. Darüber hinaus möchtest du deine Kampagnen und Use Cases ggf. global umsetzen und nicht pro Markt. Bspw. willst du eventuell Warenkorbabbrecher in der DACH Region mit gleichen Angeboten „targeten“. In einem globalen Account musst du den Use Case entsprechend nur einmal bauen, statt ihn pro Markt aufzusetzen. Das reduziert wiederum nicht nur die Setup Kosten für den Use Case, sondern spiegelt sich auch langfristig in der Maintenance und Optimierung der Use Cases wider. Das setzt aber auch voraus, dass deine Werbenetzwerke global organisiert sind. Andernfalls läufst du Gefahr, den Überblick bei den Konnektoren für die Aktivierung zu verlieren. Stell dir vor, du hast 30 Märkte und alle haben einen eigenen Tiktok und DV360 Account. Dann hast du zentral schon mal 60 Konnektoren, die du verwalten musst.
Team-Synergien und Know-How Transfer
Darüber hinaus benötigt man für den Betrieb einer CDP ein cross-funktionales Team, bestehend aus verschiedensten Rollen wie z.B. Daten-Experten, Audience Managern und technischen Profilen. Falls du das pro Markt lokal abbilden kannst, Glückwunsch! Viele Leser werden dich dafür beneiden.
In den meisten Fällen dürfte das aber zu Kapazitätsengpässen führen.
Baust du ein solches Team aber nur einmal auf, kannst du auch hier signifikante Synergien rausholen. Gleichzeitig hast du den Vorteil, dass ein zentral organisiertes Team das gesamte Know-How trägt und dieses entsprechend in alle Märkte übertragen kann, während der Know-How Transfer bei lokalen Teams sehr viel schwerer zu organisieren ist.
Standardisierung ist der Schlüssel für globale CDP-Ansätze
Im Kontext einer Customer Data Platform, die so viele neue Möglichkeiten für eine effiziente Omni-Channel Experience schafft, dürfte der Begriff „Standardisierung“ zu einem entsetzten Zusammenzucken bei dem einen oder anderen Leser/in führen. Aber genau das ist der Trade-Off, wenn du von den beschriebenen Vorteilen wie Kosteneffizienz und Synergien profitieren möchtest. Voraussetzung hierfür ist aber eine global möglichst harmonisierte Infrastruktur mit gleichen oder ähnlichen Datenquellen, Datenstrukturen, Use Cases und im besten Fall auch identischen Aktivierungskanälen. Ist das der Fall, kannst du neue Ideen und Kampagnen mit maximaler Effizienz gleich global ausrollen. Das gibt dir zudem die Möglichkeit, mit deinen Tech-Experten einen Release-Zyklus mit Standard-Releases einzuführen, was nicht nur die Release-Kommunikation in Richtung deiner internationalen Stakeholder vereinfacht, sondern auch die Aufwände bei der Maintenance deutlich reduziert. Wenn deine Websites, Online-Shops oder CRM-Systeme international aber unterschiedlich sind, wird sicherlich auch die Datenstruktur eine andere sein. Selbst bei identischen Use Cases musst du dann pro Markt eigene Audiences bauen und jede CDP Instanz wird zu einer Custom Lösung. Eine solche Struktur zentral zu verwalten dürfte ziemlich schnell zu einem Albtraum werden.
Fazit
Im Prinzip ist die Faustformel ganz einfach:
je einheitlicher dein globales Setup ist, umso eher lohnt sich eine zentrale Strategie für deine Customer Data Platform.
Entscheidend sind aber vor allem die Daten und deren globale Verfügbarkeit. Kannst du global mit den gleichen Datenstrukturen arbeiten, kannst du auch deine Audience-Strategie und damit dann auch deine Use Cases international vereinheitlichen. In der Regel ist die Realität aber etwas komplizierter als nur schwarz oder weiß. Du musst dann für dich entscheiden, welche Vorteile für dich wichtiger sind oder mit welchen Nachteilen du besser leben kannst.